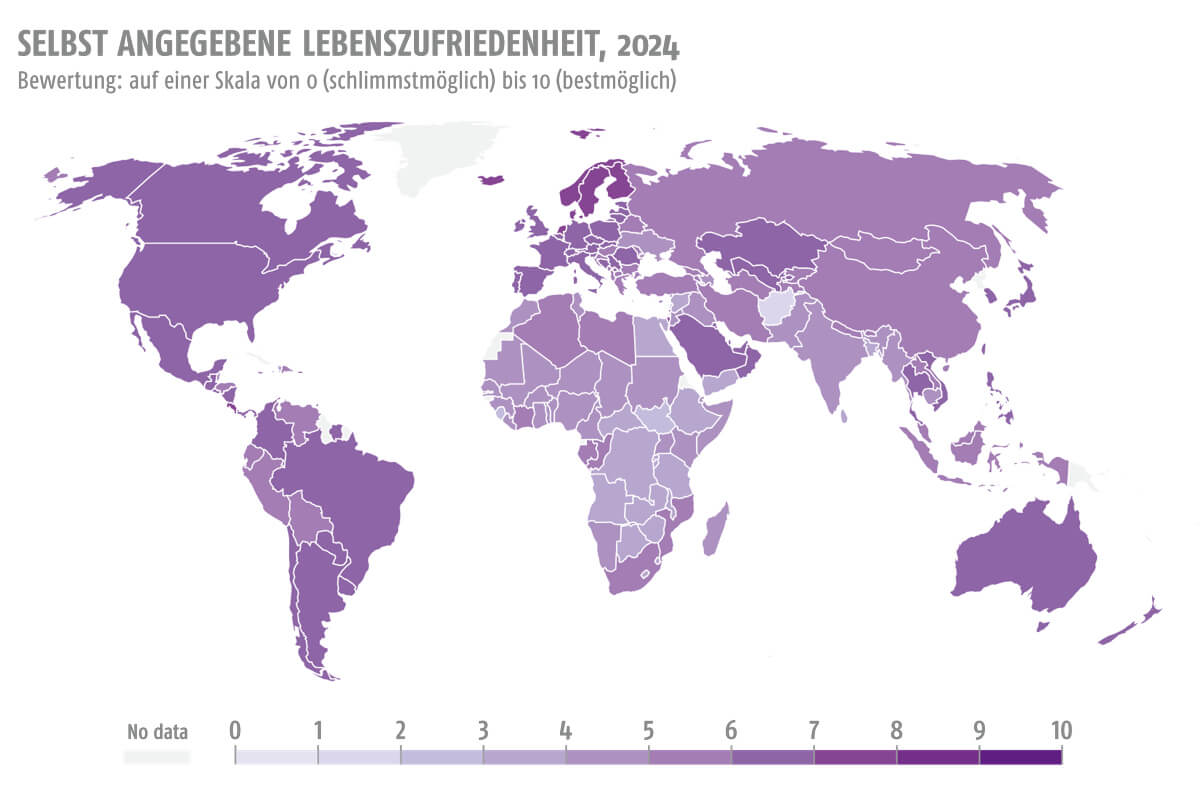
In Kuba beginnen die Reformen vom Parteitag letzten Jahres langsam zu greifen. Allerdings ist unsicher, ob die neuen Kleinstunternehmen auch überlebensfähig sind.
Auf den Plazas de la Revolución von Havanna und Santiago de Cuba stehen noch die Gestänge der Bühnen, auf denen der Papst im vergangenen März seine Messen gelesen hat. Sein Besuch war harmonisch verlaufen. Menschenrechtsgruppen beklagten zwar präventive Festnahmen. Bei versuchten Kirchenbesetzungen durch MenschenrechtsaktivistInnen, wie den „Damen in Weiß“, waren es jedoch oft die Priester selbst, die die Polizei riefen. Man wollte Provokationen vermeiden, um den Prozess der Annäherung zwischen katholischer Kirche und Staat nicht zu gefährden. Die Regierung hatte die Tage der Messen für arbeitsfrei erklärt und dekretierte gleich nach der Abreise Benedikts wunschgemäß den Karfreitag zum gesetzlichen Feiertag. (Nach dem Besuch von Johannes Paul II. im Jahr 1998 war Vergleichbares mit dem 25. Dezember geschehen.) Ostern 2012 fanden in Kuba allerorten Prozessionen und Messen unter freiem Himmel statt, nicht selten mit Rockmusik-Einlagen, die Optimismus verströmten.
Optimistisch sind auch Natalia und Claudio. Das Geschwisterpaar betreibt in Alt-Havanna einen Laden „auf eigene Rechnung“. Solche Kleinunternehmen entstehen seit einem Jahr massenhaft, nachdem die Regierung die „cuenta propia“ als Instrument der Krisenbewältigung wiederentdeckt und die Erteilung von Lizenzen erleichtert und erweitert hat. Landauf, landab werden nun belegte Brötchen, Pizzas, selbst gebrannte CDs feilgeboten, eröffnen kleine Restaurants, bieten Handwerker Dienstleistungen an, suchen private Taxis nach Fahrgästen. Meist als Einmann- bzw. Eine-Frau-Betrieb.
In manchen Sektoren darf man auch familienfremdes Personal anstellen. Das ist neu. Die Geschwister haben eine Lizenz für den Verkauf von „Haushaltsbedarf“ – und der ist groß. Die Bausubstanz ist schlecht. Zu reparieren ist immer etwas. Das Sortiment, das auf einem Tischchen in der Tür zum zementverputzten Parterrewohnzimmer drapiert ist, reicht von ein paar Schrauben und Muttern, Nägeln, Elektrokabeln, Klebeband, einem Stück Gartenschlauch über Plastikbecher bis hin zu Kämmen und Haarbürsten. Für die Lizenz zahlen sie eine fixe Abgabe von 160 Pesos im Monat, was bei einem Mindestlohn von 225 Pesos viel Geld ist. Doch die Nachfrage ist gut, der Renovierungsbedarf immens. Der geschwisterliche Mini-Baumarkt versorgt sich selbst über den Schwarzmarkt. Großmärkte, auf denen sich die Jungunternehmer mit Waren eindecken könnten, gibt es (noch) nicht. Der Gründerboom ist so groß, dass momentan für Alt-Havanna keine neuen Lizenzen mehr erteilt werden, berichtet Claudio: „Für andere Stadtteile und Städte aber schon.“
Die „cuenta propia“ ist ein Herzstück der Wirtschaftsreformen, die auf dem Parteitag der Kubanischen KP vom April letzten Jahres beschlossen wurden. Die Rolle des Staates sollte reduziert, Privatinitiativen erweitert werden. Im Kern geht es um die Verkleinerung des Personals der aufgeblähten und maroden Staatsbetriebe. Potenziell sind 1,3 Millionen Menschen von den geplanten Entlassungen betroffen, mehr als zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. Sie sollen in der Arbeit auf eigene Rechnung eine neue Existenzgrundlage finden. Doch statt den für das erste halbe Jahr vorgesehenen 500.000 Personen verloren nur 127.000 ihren Job. Die Zahl der „cuenta propia“- Betriebe hat sich im gleichen Zeitraum von 145.000 auf 350.000 mehr als verdoppelt. Vielfach wurden bisher bloß „schwarz“ betriebene Unternehmungen angemeldet statt neue gegründet. Schließlich wurde die Arbeit auf eigene Rechnung vor zwanzig Jahren nach dem Zusammenbruch der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ostblock schon einmal als Rettungsanker aus dem Hut gezaubert. Mit einer Rede von Raúl Castro im März 1996 wurde dann aber der ganze Reformprozess abgewürgt, als das Schlimmste überstanden schien.
Es folgten Jahre einer leichten Erholung auf niedrigem Niveau, bis die Insel im Jahr 2008 von drei Hurrikans und den Auswirkungen der Weltfinanzkrise getroffen wurde: Rückgänge beim wichtigsten Devisenbringer Tourismus – und bei den wohl ebenso wichtigen Überweisungen vom Familienmitgliedern aus dem Ausland – sowie ein Verfall der Nickelpreise brachten Kuba an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. Im Jahr 2009 dürfte man nur knapp an einer Hungersnot vorbeigeschrammt sein.

„Auf eigene Rechnung“ im Wohnzimmer –
verkauft wird alles, was aufzutreiben ist.
Im Vorjahr wurde der damals 51-jährige Marino Murillo als eine Art Superminister für den wirtschaftlichen Umbau installiert und zusammen mit seinem Nachfolger im Amt des Wirtschaftsministers, Adel Izquierdo, in das verkleinerte Politbüro berufen. Bei wichtigen Anlässen wie den Papstmessen war Murillo an der Seite von Präsident Raúl Castro zu sehen. Die Reformen sollen „mehr Sozialismus“ ermöglichen, versprechen Plakate. Dass ein Systemwechsel nicht auf der Reformagenda steht, davon kündet schon der Umstand, dass dem nunmehr 15-köpfigen Politbüro sechs Armeegeneräle und ein ehemaliger Chef der Staatssicherheit angehören. Der Generalsekretär des Politbüros war 50 Jahre lang Verteidigungsminister.
Neben der „eigenen Rechnung“ wurde auch ein privater Markt für Immobilien und für Autos zugelassen. Viele Kubanerinnen und Kubaner sehen die neuen Freiheiten mit Enthusiasmus, waren sie doch seit vielen Jahren auf das Improvisieren und den Schwarzmarkt angewiesen. Allein mit regulärer Arbeit und der staatlichen Lebensmittelkarte war ein Auskommen schon lange nicht mehr zu finden. Gleichzeitig wurde noch nie so offen Kritik geübt. Noch immer herrscht vielfach Rechtsunsicherheit. Vieles ist Sache von Einzelfallentscheidungen. „Wir können uns keine Fehler mehr leisten“, rechtfertigt Raúl Castro die langsame Umsetzung der Reformen.
Wichtiger allerdings ist die Frage, ob diese nicht überhaupt zu spät kommen und ob sie ausreichen. Nach anderthalb Jahrzehnten Stillstand genügt es nicht, die Menschen nun sich selbst und ihrer Eigeninitiative zu überlassen. Es muss nicht nur gespart, es muss vor allem mehr produziert werden. Auf der fruchtbaren Insel werden 80 Prozent der Lebensmittel importiert und dafür fast die gesamten Deviseneinnahmen ausgegeben. Dass in dieser seit Jahren andauernden Situation 3,6 von 6,6 Millionen Hektar Staatsland brach liegen, macht fassungslos. Der Versuch, in der Landwirtschaft Genossenschaften zu errichten, war Mitte der 1990er Jahre an bürokratischen Hemmnissen gescheitert. Inzwischen wurde eine Million Hektar Land an Privatleute verpachtet. Doch die sind vielfach keine Bauern mit Erfahrung. Sie klagen nicht nur darüber, dass sie einen Großteil der Ernte zu Niedrigstpreisen an den Staat abführen müssen. Vor allem seien zehn Jahre Pacht viel zu kurz, damit sich die Urbarmachung und andere Investitionen rentieren. Anfänglich war es ihnen sogar verboten, Gebäude auf dem Gelände zu errichten: also auch keine Lagerräume oder Werkzeugschuppen. Derzeit wird über weitere Anpassungen wie eine Verlängerung der Pachtfristen nachgedacht.
Vor zwanzig Jahren hatte mir ein Hotelmanager in der Touristenenklave Varadero erklärt, dass seine Tomaten aus Kalifornien sind, wegen des US-Embargos aber über Kanada geliefert würden – zumindest auf dem Papier. Ich hatte mich damals gefragt, wieso sie im dritten Krisenjahr noch immer nicht vom Feld nebenan kämen: Die Gastronomie würde so frische Lebensmittel, die Bauern ein Zusatzeinkommen und der Staat – wenn er es klug anstellte – mehr Steuereinnahmen bekommen. Seit Herbst letzten Jahres dürfen Bäuerinnen und Bauern direkt an Restaurants und Hotels liefern. Dieser kleine historische Rekurs lädt zu zwei Reflexionen ein. Erstens: Muss staatliche Wirtschaftsplanung derart unflexibel und schlecht sein? Und zweitens: Welchen Anteil hatten die Sanktionen gegen Kuba daran, dass die Führung in einer Bunkermentalität erstarrte?
Washington hatte auf den kubanischen Reformprozess der 1990er Jahre mit einer Ausweitung und Verschärfung seiner Wirtschaftsblockade reagiert. Die Europäer hatten teilweise halblaut protestiert, aber keine Alternative dazu entwickelt.
Kuba ist eine stark vom Außenhandel abhängige kleine Insel. Die Reaktion des Auslands wird eine nicht unwesentliche Rolle für Erfolg oder Misserfolg des aktuellen Reformprozesses spielen.
Südwind-Mitarbeiter Robert Lessmann hat in den 1990er Jahren im Auftrag der deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung eine Reihe von Studien zu den Wirtschaftsreformen in Kuba geschrieben, die dort kostenlos erhältlich sind. Die Papstmesse in Havanna hat er für den ORF als Ko-Kommentator live begleitet.







